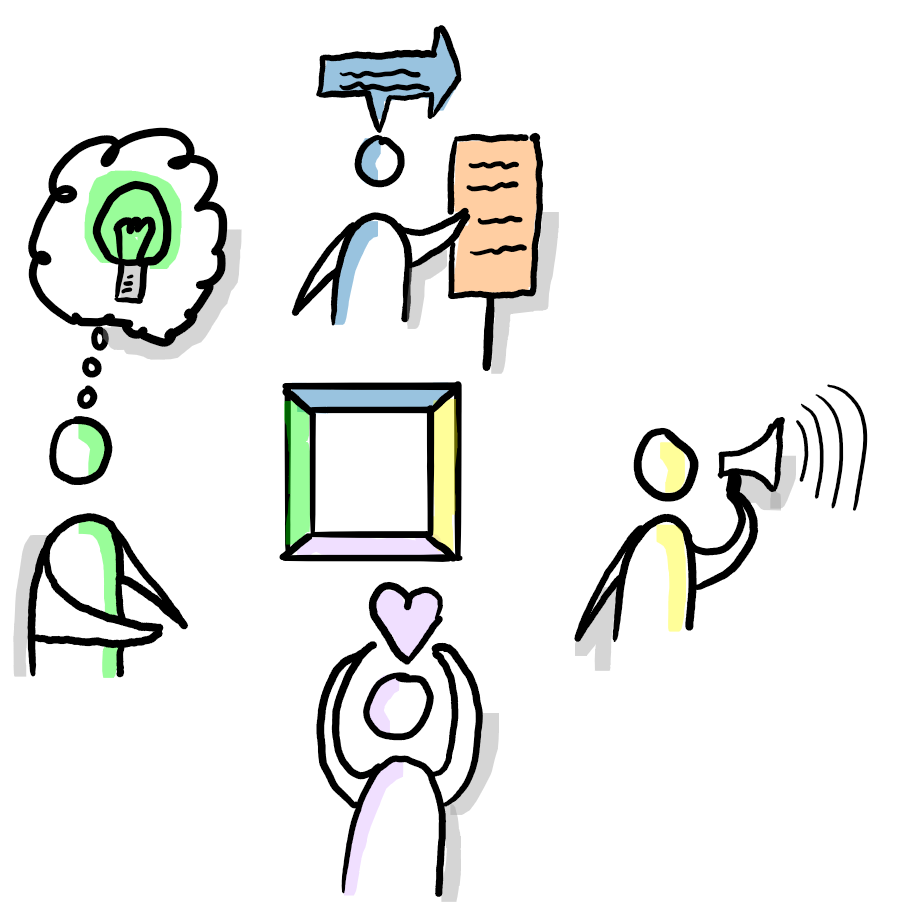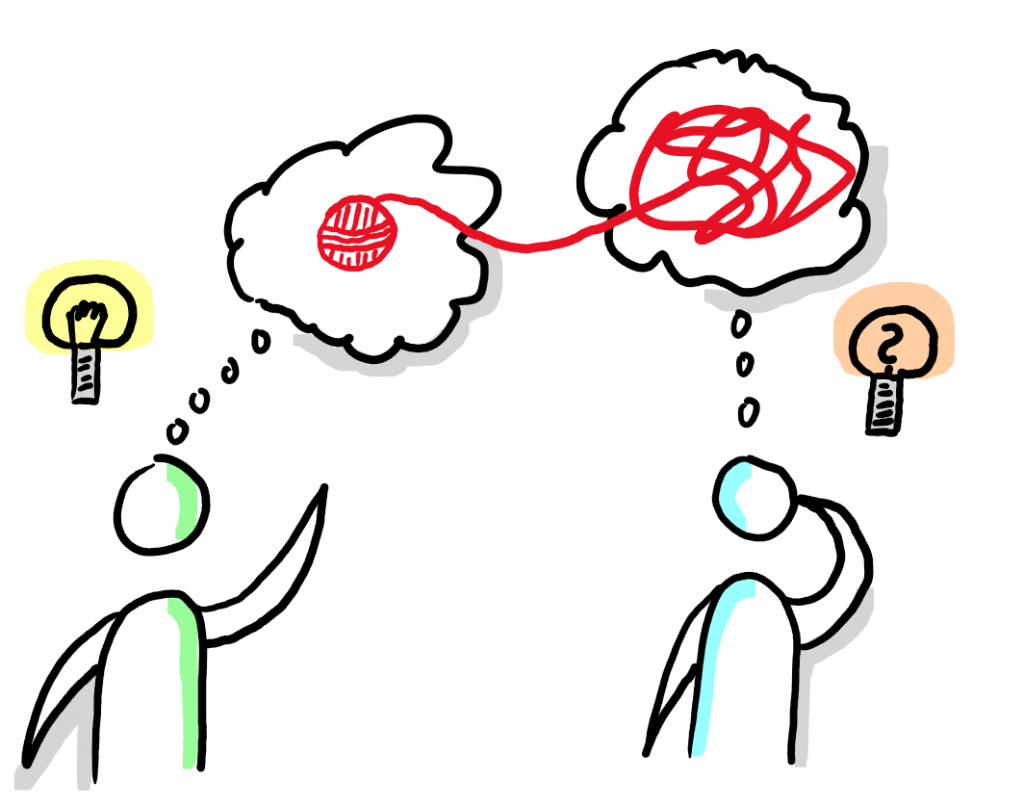Klingt das Wort da oben etwa ein bisschen wie der DEMENTOR aus Harry Potter? Na ja, die Ähnlichkeit ist vielleicht gewollt. Als Lehrer in einer Berufsfachschule stehe ich nicht selten vor dem Problem, junge Menschen zum Lernen motivieren zu müssen. Man geht ja immer naiv davon aus, dass die alle im Unterricht nicht nur physisch, sondern auch psychisch präsent sind, weil sie sich ja freiwillig für diese Berufsausbildung entschieden haben. PUSTEKUCHEN. Geht man dann nämlich durch die Reihen, stellt man durchaus fest, dass da nebenher ganz andere Dinge eine Rolle spielen. Vielleicht, weil nicht jedes Thema jeden Menschen gleich stark interessiert. Was zunächst vollkommen legitim ist. Allerdings ist das ALLERMEISTE davon am Ende prüfungsrelevant. Aber das geht ihnen erst so ca. vier Monate vor Schluss auf – und dann gehen ihnen noch ganz andere Dinge; z. B. die Düse, oder der Arsch auf Grundeis. Fakt ist, dass man nicht JEDE:N zu ALLEM gleich gut motivieren kann. Aber zumindest kann man versuchen, Interesse zu erzeugen, denn Interesse hilft bei der intrinsischen Motivation (vgl. hierzu Krapp 1999, S. 400 ff).

Man könnte im Umkehrschluss sagen, dass schlechtes Unterrichtsdesign, vor allem aber auch schlechtes Aufgabendesign die Motivation der Schüler:innen vernichten, oder anders gespochen absaugen kann, so wie ein Dementor seinem Opfer alle Emotionen und Affekte absaugt und es psychisch verkrüppelt zurücklässt. Nun führt ein, oder auch mehrere nicht optimal gelaufene Unterrichte mitnichten dazu, Schüler:innen psychisch zu verkrüppeln. Wohl aber kann es mit der Zeit zu einer insgesamt sinkenden lernmotivation führen, die zu schlechteren Leistungen führt (wir müssen halt taxonomieren, also Noten geben), was widerum zu einer sinkenden Lernmotivation führt, was… der Teufelskreislauf ist leicht zu erkennen, wenn man denn möchte. Eines der großen Probleme hierbei ist, dass selbst bei hinreichend guter, ausgewogener, methodenpluralistischer Vorbereitung durch Pädagogen, wie bereits oben erwähnt, nicht alle Menschen auf die gleiche Weise zu packen sind. Nun haben junge Erwachsene zwar noch keine voll ausgereifte Selbstkontrolle, sind aber schon ein Stück des Weges gegangen; weshalb man die zumeist irgendwie auf die Spur bekommt. Bei Grundschulkindern ist dies jedoch NOCH nicht der Fall.
Ich bin nicht nur Pädagoge, sondern auch Vater. Und meine kleinere Tochter ist, wenngleich ein kluges, wortgewandtes, sportliches Kind auch ein ziemlicher Sturkopf – und unter dem ganzen Bohei, den sie verzapfen kann ein eher sensibler Mensch. Nun ist es so, dass die Grundschule hier in Deutschland nachweislich darauf angelegt ist, die Kinder zu normieren, in Schubladen zu packen und zur passenden pädagogischen Weiterbearbeitung an die “richtige” Folgeschulform zu verweisen. Ich meine das nicht böse. Es gibt gewiss jede Menge Pädagogen:innen da draußen, die ihr Bestes geben, ihren Schülern:innen Spaß am Lernen zu vermitteln; aber das primäre und sekundäre Schulwesen in Deutschland sind – Marktwirtschaft sei Dank – darauf ausgerichtet, möglichst viele, möglichst reibungslos in den Arbeitsmarkt integrierbare Humanressourcen zu dressieren! Und nicht wenige Pauker:innen haben eben dies so sehr verinnerlicht, dass sie die Notwendigkeiten dieses “Dressierens” bis zum bitteren Ende durchdeklinieren! Mit der Folge, dass Kinder wie meine kleinere Tochter an der Schule verzweifeln. Denn sie LÄSST SICH NICHT EINPASSEN!
Ja, da müsste ich in meiner Funktion als Lehrer und Leiter einer Berufsfachschule doch Jubeln – da kommen doch lauter super beschulbare Drohnen zu mir, oder? NÖ! Da kommen nicht selten Menschen, denen man das Lernen Wollen von Grund auf verleidet hat und denen, in der Folge, meine Kollegen und ich mit Mühe wieder beibringen müssen, für sich selbst und seine Ziele Eigenverantwortung zu übernehmen (ich verweise hier auf das Thema “Metakognitive Strategien” stärken, über welches ich im letzten Post dieser Serie gesprochen hatte). Schaue ich nun auf meine kleine Tochter, könnte ich im Strahl kotzen, wenn ich z.B. höre, dass sie ein Referat mit einem frei wählbaren Thema halten darf/soll, allerdings erst im Nachhinein sehr spezielle Formatvorgaben gemacht werden und dann bemängelt wird, dass die Kinder sich nicht an diese Vorgaben gehalten hätten. Also ich sage mal, wie man das bei uns macht: für selbstorganisierte Arbeitsaufträge gibt es auch bei jungen Erwachsenen Vorgaben hinsichtlich Quellen, Zeitansätzen, Meilensteinen und Formaten, die zuvor transparent kommuniziert werden. Innerhalb dieser Vorgaben ist jedoch eine Menge Kreativiät möglich – und wünschenswert. Andernfalls bekomme ich nämlich keine Eigenleistung, sondern irgendwas – was bei einer 10jährigen dann vermutlich auch noch eine Menge Starthilfe von den Eltern benötigt, weil ein Kind in dem Alter in aller Regel noch nicht auf der formal-operationalen Stufe der kognitiven Entwicklung angekommen ist, die es aber braucht, um komplexe Zusammenhänge erfassen und darstellen zu können. Insbesondere, wenn man auch noch erraten muss, was der/die Pädagoge:in denn nun sehen möchte, oder auch nicht! Befasst man sich heutzutage in der Pädagogen:innen-Ausbildung nicht mehr mit Piaget, Erikson, Kohlberg…?
Ich las neulich Bob Blumes Buch “10 Dinge, die ich an der Schule hasse […]” und ich musste leider bei sehr vielen Absätzen nicken und hatte dabei den schulischen Werdegang beider Kinder, vor allem aber den meiner jüngeren Tochter vor Augen. Mit deviantem Verhalten und originellen Denk- und Argumentationsstrukturen (ich habe beide Kinder vom frühest möglichen Zeitpunkt an mit Ironie gegängelt, damit sie mir jetzt ordentlich Kontra geben können – Gott wie ich das hasse, wenn ein Plan funktioniert…) können eine Menge Lehrkräfte offenkundig schlicht NICHT umgehen. Und nutzen daher ihre “Machtposition”, um das Kind zu disziplinieren. Und die Eltern am Besten gleich mit, damit die das Kind auch schön in Form pressen helfen. Bei uns funktioniert das nicht. Und ich gebe ehrlich zu, dass ich manchmal einfach nur nicke wie der Wackeldackel, mir mein Teil denke und tue, was ICH für richtig halte! Denn am Ende müssen das Kind selbst und ICH es den Rest meines Lebens miteinander aushalten – nicht die Pädagogen:innen, die es gerade mit Ansage verbocken! Daher ist mir deren Meinung – auch weil ich selbst Pädagoge bin – herzlich gleichgültig. In ein paar Wochen ist dieses Kapitel eh rum, dann kommt meine Kleine in die Sekundarstufe. Was dann passiert, wird sich weisen. Aber noch mal ganz ehrlich: am Ende fragt keine Sau mehr nach den Noten der 7., 8., 9. Klasse! Der Mensch, der dabei am Ende rauskommt soll eigenständig denken und lernen, kritisch sein, für sich selbst einstehen und trotzdem Spaß am Leben haben können! Dann haben wir als Eltern nicht alles falsch gemacht! In diesem Sinne – Urlaub rum, morgen ruft die Arbeit. Drauf geschissen. Euch ‘ne schöne Woche!
- Krapp, A. (1999): Intrinsische Lernmotivation und Interesse. Forschungsansätze und konzeptuelle Überlegungen. Zeitschrift für Pädagogik, 45(3), 387-406.
- Blume, B. (2022): 10 Dinge, die ich an der Schule hasse und wie wir sie ändern können. München: Mosaik Verlag.