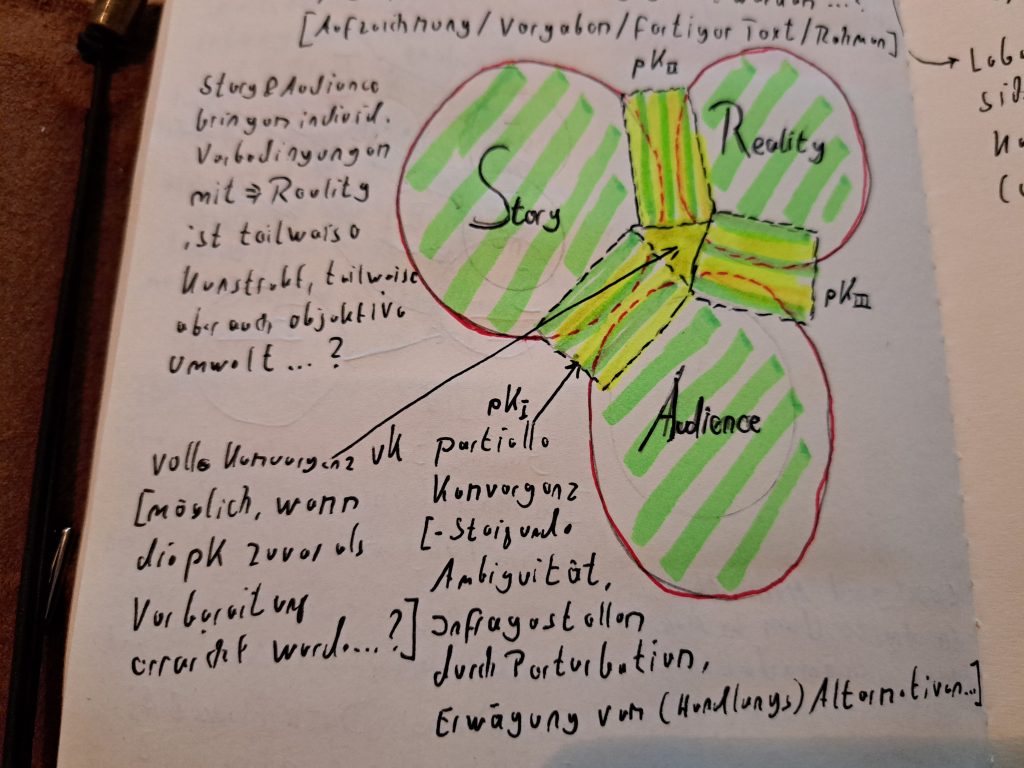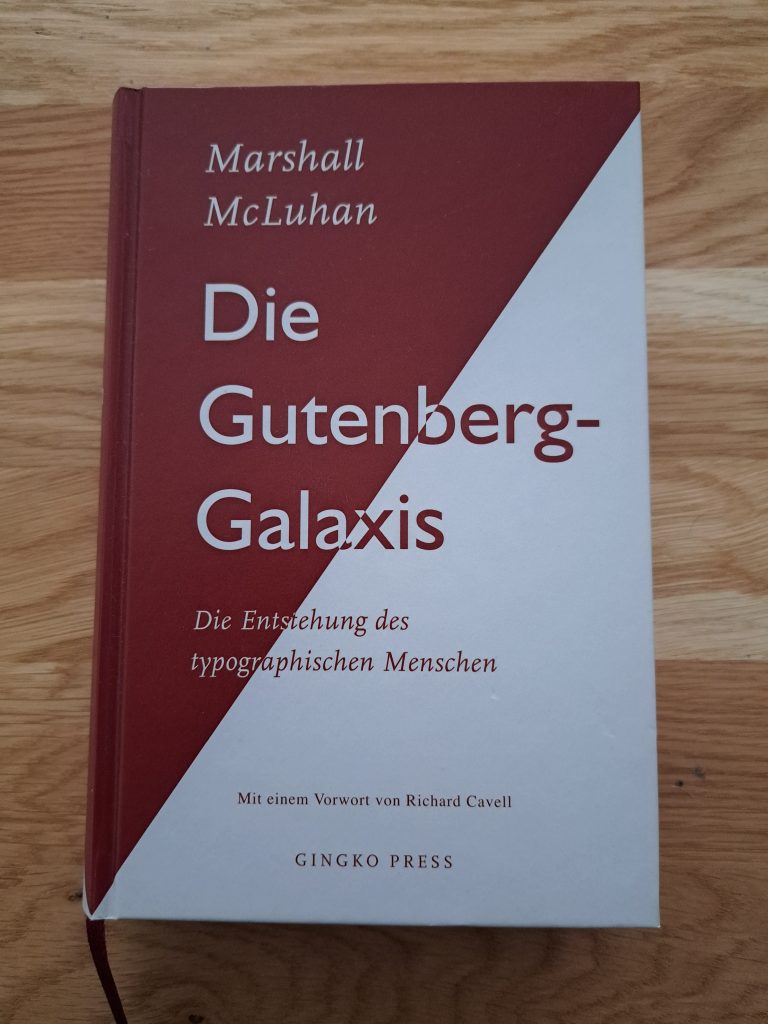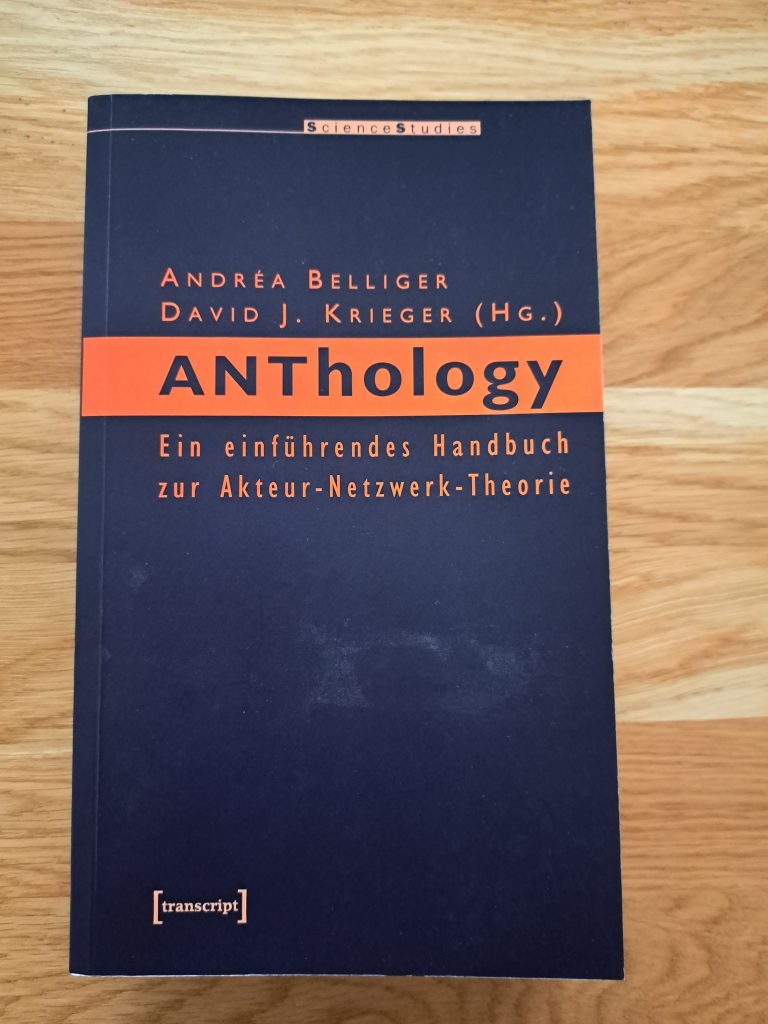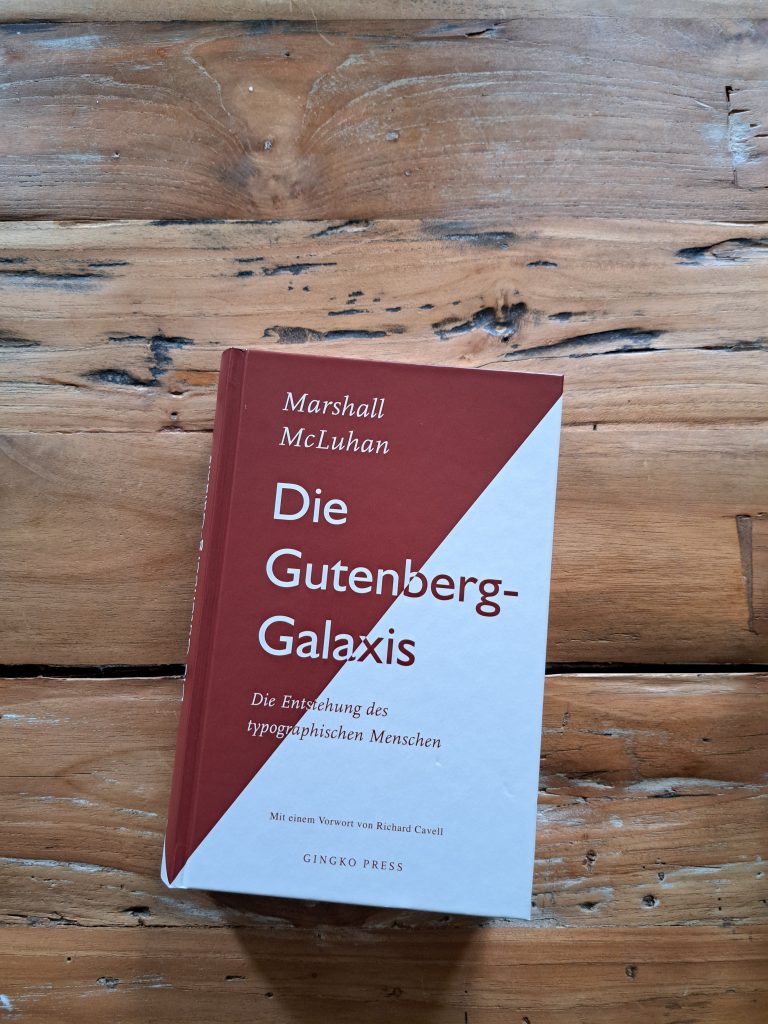Gedankenspiel N°1: Neo nahm damals die rote Pille und wurde aus der Matrix gerissen. Wie würden wir diese Geschichte bewerten, wenn nun ans Licht käme, dass “die Matrix” die echte Realität wäre, und der Kampf gegen die Maschinen um eine zur Ödnis gewordene Welt die Illusion? Wenn Neo (wahrscheinlich, ohne dies zu wissen) in ein besonders intensives, besonders immersives Spiel in einer virtuellen Realität gezogen worden wäre, hergestellt und kuratiert, um Menschen eine Grenzerfahrung zu ermöglichen und sie zum Nachdenken über ihre Existenz anzuregen? Die Ausflüge in die Realtität, bei denen all diese Dinge geschehen, welche die Geschichte vorantreiben, wären Wahrheit und der Umstand, dass Neo am Ende Agent Smith eingebettet in den Code sieht, nur ein weiterer Hinweis darauf, dass die Welt von Mr. Anderson mit allem darin immer schon “nur” eine andere virtuelle Realität war. Wäre dann irgendwas von der Geschichte – natürlich innerhalb ihrer eigenen Logik – weniger wahr? Oder vielleicht sogar besser verständlich? Doch wer erschuf dann diese große Simulation, in welcher Menschen (oder wer auch immer) eine weitere Simulation installierte, um eben einen Ausbruch aus der Matrix erleben zu können…?

Gedankenspiel N°2: Neo hat die Handlung der Filme offenbar nur geträumt, erwacht dann morgens als Mr. Anderson, geht zu seiner Arbeit und begegnet unterwegs jemandem, der aussieht, wie Agent Smith. Oder Morpheus. Oder Cypher. Könnte es ein Taaum in einem Traum in einem Traum sein? So wie im Film “Inception”. Und war “Inception” überhaupt ein Film, oder nicht vielmehr eine kuratierte Erfahrung über die existenzielle Frage, was es nun ausmacht, dieses Phänomen namens “Bewusstsein”? Denn trotz allem, was wir wissen, kann niemand bis heute genau sagen, was Bewusstsein denn nun ist. Bis vielleicht auf das eine: es scheint eine hoch individuelle Angelegenheit zu sein, die sich durch das physische Abbild eines neuronalen Netzes allein nicht erklären lässt. Ist aber diese neue Interpretation der Ereignisse dann nicht ein Hinweis auf die Virtualität mehrerer, ineinander eingebetteter Realitäten? Und was bedeutet das für Neo/Mr. Anderson, oder besser gesagt für seine Realheit und sein Bewusstsein. Ist er real, so wie du und ich? Und falls ja, hat er überhaupt ein Bewusstsein, oder ist er das, was man einen philosophischen Zombie nennt – also ein Wesen, dass wirkt wie ein echter Mensch, jedoch NICHT über ein tatsächliches Bewusstsein verfügt?
Gedankenspiel N°3: Wir alle sind – wie Neo/Mr. Anderson – irgendwo zwischen ineinander verschränkten Instanzen eines virtuellen Realitäts-Multiversums unterwegs und erleben bzw. durchleben unsere jeweils individuell simulierten virtuellen Realitäten. Woraus sich einerseits die Frage ergibt, ob wir tatsächlich ein Bewusstsein haben (falls meines nur eine Simulation sein sollte, würde ich mich sehr gerne mal mit dem/der Programmierer*in unterhalten…!), wenn wir doch “nur” Simulakren sind; und andererseits, ob das unsere Realitäten weniger… nun REAL machen würde. Immerhin fühlt sich das alles hier doch VERDAMMT echt an, nicht wahr. War da nicht dieser selbsternannte Tech-Guru aus Südafrika, der mit Hilfe seiner Neuralink-Technologie diese “Illusion hacken” und uns aus der Simulation befreien will. Wäre es nicht total nice, erst mal über die Frage nachzudenken, ob das überhaupt Sinn ergibt. Denn selbst, wenn das alles so wäre, könnte es doch gut sein, dass wir gar kein physisches Korrelat außerhalb der Simulation haben, also keine Avatare sind, sondern tatsächlich “nur” Simulakren, die sich allerdings soweit entwickelt haben, dass sie nun ein Bewusstsein, eine Agenda und vor allem Macht über die Simulation besitzen, ohne diese je verlassen zu müssen…? Ich glaube ja, wenn es so wäre, bräuchten wir Menschen definitiv keinen allwissenden, omnipotenten Simulator, um unser Schicksal zu besiegeln. In dieser Realität, oder auch der nächsten kriegen wir das schon alles ganz alleine kaputt…
David Chalmers spekuliert in seinem Buch “Realität+ – Virtuelle Welten und die Probleme der Philosophie” über die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einer Simulation leben. Im krassen Gegensatz zu Elon Musk erarbeitet er allerdings ein recht fundiertes Framework, um sich den vielen, teils existenziellen Fragen praktischer und philiophischer Natur, die sich aus einer solchen Spekulation ergeben Antworten abzutrotzen, die uns im Hier und Jetzt (ganz gleich, wie virtuell oder auch nicht-virtuell) dienlich sein können; wenn man sich denn auf die Reise einlässt. Und nur für den Fall, dass jetzt irgendjemand denkt, ich sein gerade im Begriff, Urlaubsgenussinduziert überzuschnappen – keine Sorge! Ich finde nur derzeit große Freude daran, mich mit Fragen rings um den Themenkomplex zu befassen, weil ich denke, einige Ideen hieraus für’s private Storytelling, aber auch für das im Lehrsaal nutzbar machen zu können. Und weil ich glaube, dass eine handfeste Auseinandersetzung mit dem, was uns als Menschen im Kern ausmacht regelmäßig stattfinden sollte. Denn verbunden mit jener Reise durch die Grenzgebiete des Denkbaren wirft Chalmers Buch auch die Frage nach der Natur unserer Realität(en) und unseres Bewusstseins auf, die untrennbar mit unserer Suche nach dem Sinn unserer Existenz verbunden sind. Wenn man so will, ist das Buch für den aufmerksamen Leser das (wenn physisch auch sehr zahme) Substrat einer Grenzerfahrung, wie Neo/Mr. Anderson diese in/außehalb/meta der Matrix erlebt. So jetzt habe ich für heute auch genug virtuellen Quatsch abgesondert. Auch, wenn das hier KEIN Aprilscherz war. Schönen Abend.