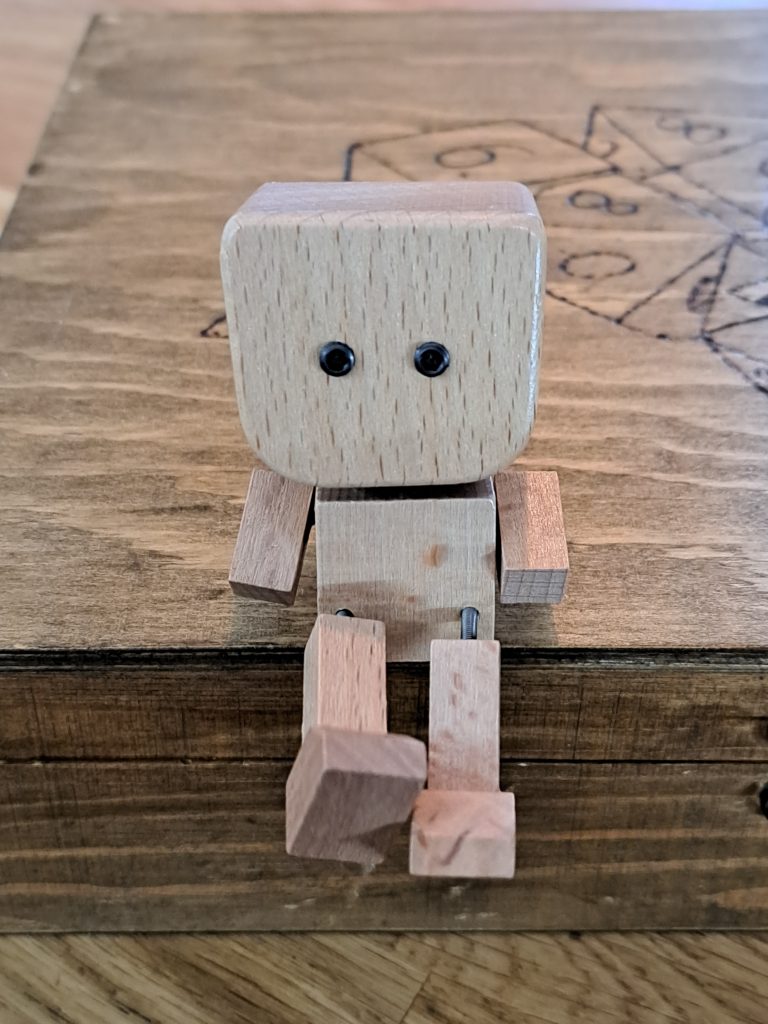Ich. Weiß. Ja. Auch. Nicht… Aber irgendwie ist meine Konditionierung mittlerweile soweit voran geschritten, dass ich es tatsächlich oft kaum aushalte, nichts “produktives” zu tun. Ich meine, unsere Gesellschaft – oder besser, jener Teil unserer Gesellschaft, der sich für Leistungsträger hält und glaubt, jeden Aspekt des Daseins optimieren zu müssen – ist so BESESSEN davon, produktiv sein zu müssen, dass viele anscheinend auch dann nicht stillhalten, innehalten, sich von Arbeit abhalten können, wenn beim besten Willen keinerlei Veranlassung dazu besteht, irgendetwas zu leisten. Beispiel: es ist noch Sonntag und ich habe diesen Tag (irgendwie auch den gestrigen Samstag) mehr oder weniger vollständig mit Dingen verludert, die keinem anderen Zweck dienten, als mich zu unterhalten. Meine einzigen Ausflüge in die Welt des Tun Müssens waren kochender Natur, denn irgendwann möchte die Familie ja mal was zu beißen haben. Aber auch hier galt: lean production. Nix aufwendiges. Einfach und schnell aber hinreichend lecker. Den Rest der Zeit habe ich mit Lesen, Schreiben und etwas Zocken verbracht. Und das wars. Man könnte mir nun also durchaus vorwerfen, dass ich faul gewesen sei – und derzeit immer noch bin, weil man hätte ja…! Aber… was hätte man denn…? Weggehen, irgendwas Schönes anschauen, irgendwas Wildes unternehmen, am besten auch noch im Beisein anderer Menschen…? IGITTIGITT… Menschen! Hab schon genug davon gesehen, mein Bedarf ist derzeit mehr als gedeckt. Als extravertierter Introvertierter ist es allerdings beizeiten gar nicht so schwer, den Kanal von Menschen total voll zu haben. 10 Minuten Nachrichten und/oder Antisocial Media reichen vollkommen um meinen Monatsbedarf an Bullshit zudecken. Nein, ich mag derzeit nicht unter Menschen, außer es dient dem Geldverdienen (gezwungen) oder der Therapie (gewünscht). Der Rest der Welt kann mich mal…

Und doch sitze ich am Sonntagabend hier und schreibe einen Blogpost, obschon ich gar nicht so recht weiß, warum ich das eigentlich tue… oder besser, ich weiß schon, dass ich es tue, weil es sich sonst für mich so anfühlen würde, als wenn ich das ganze Wochenende verschwendet hätte. Aber… ist das so? Verschwende ich Zeit, indem ich mich durch ein Tun erhole, dass mich erfreut, selbst wenn im Grunde nix dabei rumkommt; außer evtl. Spaß? Ich denke mittlerweile, dass nicht wenige Menschoide da draußen deshalb ihr Leben, Ihre Unternehmungen, auch ihre Errungenschaften instagramisieren, weil sie kein Leben mehr leben, sondern mittels kuratierter Abbildung im weltweiten Desinformationsgewebe ihre VORSTELLUNG eines erfolgreichen Lebens SIMULIEREN. Wie verfickt armselig ist DAS denn? Alles nur fake. Das sind letzten Endes die Auswirkungen von Antisocial Media im Endstadium – alles degeneriert zu einer Performance, oder besser zu einem Wettbewerb um Likeability, Shareability und Marketability… Wer lesen kann, dem fällt auf, dass die drei Termini alle auf -ability also Fähigkeit enden. Ist es wirklch das, was wir alle sein wollen: eine Gesellschaft im Wettlauf um die Fähigkeiten für die beste Social Performance, obwohl wir allen falschen Gemeinschaftsgefühlen in unseren Filterblasen zum Trotz immer isolierter, einsamer, ausbeutbarer, ohnmächtiger werden? Immer mehr zum Spielball der gierigen Techbarone? Auch wenn das mitnichten alle Menschen betrifft, ist die Zahl derer, die sich in diese Maschinerie einspannen lassen unterdessen viel zu groß, als dass man die Bedrohung für die Demokratie, für die Teilhabe, für die Gesellschaft als Ganzes, die hiervon ausgeht einfach ignorieren könnte. Denn Menschen, die mit Vollgas in dieser Einbahnstraße unterwegs sind, werden anfällig für Einflüsterungen. Und von böser Sprache ist es über böse Gedanken nicht weit zu bösem Tun. Denn Sprache formt Bewusstsein formt Handeln…
Sich dem bewusst zu entziehen, indem man innehält, Müßiggang betreibt, Antisocial Media bleiben lässt, sich mit echten Dingen befasst, dazu lernt und insgesamt weniger durch sein Dasein hetzt, sondern mehr im Hier und Jetzt lebt, macht einen nicht automatisch zu einem besseren Menschen. Aber mittelfristig vielleicht zu einem, der wieder erlernt, wie es sich anfühlt, sich selbst und seine Umwelt bewusst zu reflektieren, ohne sich davon mittels der konstanten Bedummrieselung aus dem Blödschirm der Taschenwanze nahezu zwanghaft ablenken lassen zu müssen. Gott wäre das schön. Das ändert immer noch nichts an meinem Problem, weil ich ja immer noch am Blogpost schreibe… aber ich kann meinen Blick darauf verändern und jetzt gelassen feststellen, dass ich nicht schreibe, weil ich Angst vor zu wenig performativer Produktivität habe – also solcher, die auch schön überall gesehen werden kann – sondern weil mir meine Gedanken wichtig genug sind, sie anderen mitteilen zu wollen. Und ja, ich bin auch arrogant genug, sie als wichtig genug für andere zu erachten. Soviel EGO billige ich mir zu. Ich denke nicht, dass ich hier gerade nur Produktivität simuliere – ich denke vielmehr, dass ich einen (wenn auch kleinen) Beitrag dazu leiste, die Gesellschaft vor weiterer Verdummung zu bewahren. Und… wie viel habt ihr dieses Wochenende schon geglaubt, leisten zu müssen? Denkt daran, in gut 11h ist schon wieder Montagmorgen. Dann dürft ihr es wieder krachen lassen, wenn ihr denn unbedingt wollt. In diesem Sinne – einen langsamen Start in die neue Woche…