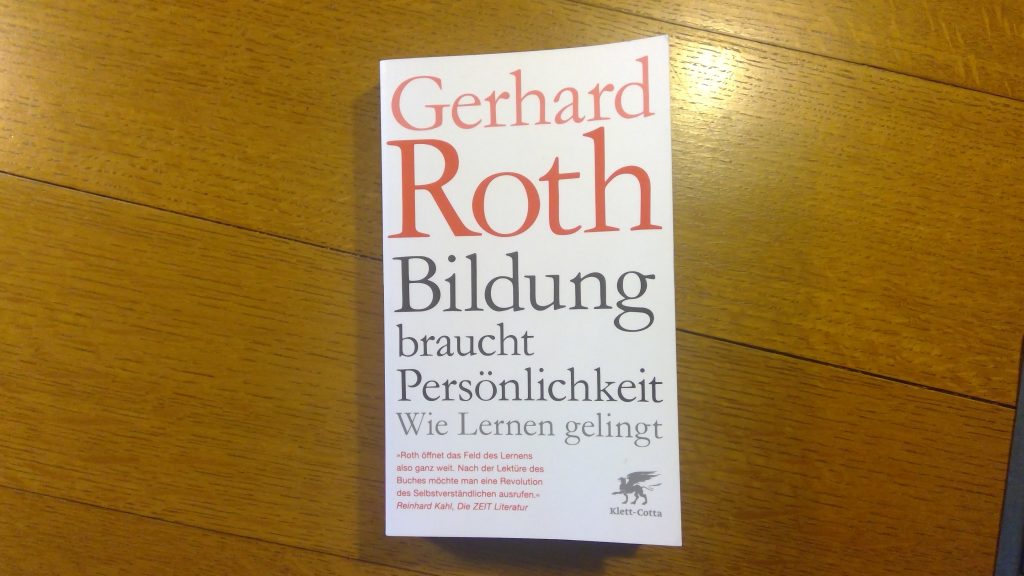Wenn man sich die gesellschaftlichen Prozesse der letzten Wochen und Monate anschaut, müsste man sich eigentlich fragen, wie es sein kann, dass verschiedenen Gruppen einander diametral gegenüberstehende Interessen mit solcher Vehemenz und solchem Dogmatismus durchzusetzen versuchen, dass Gewalt plötzlich so manchem eine geeignete Lösung zur Begrenzung von Pluralität scheint. Ob diese Begrenzung dann nur vorübergehend gelten soll, oder nicht – darüber schweigt man sich dann gerne aus. Falls jemand nicht versteht was ich meine – lest doch einfach mal Kommentarspalten unter x-beliebigen Artikeln zu x-beliebigen aktuellen Themen. Wie die Leute (vorgeblich zivilisierte und gebildete Menschen) da aufeinander losgehen, besorgt mich. In jedem Fall ist Hatespeech nun in aller Munde.
Ich rede ja nicht nur von den Protesten gegen die Maßnahmen, welche von den Behörden zur Begrenzung der Covid19-Pandemie ergriffen wurden. Tempolimit, BER, Teslas Gigafactory N°3 in Brandenburg, Fridays for Future… nirgendwo scheint man sich mal in der Mitte zur Verabredung eines einstweilen gangbaren Kompromisses treffen zu wollen. Selbst jene, die sich als Gutmenschen bezeichnen würden, schlagen mit verbalen Keulen um sich, die mich mit einem Kopfschütteln zurücklassen; was ist das überhaupt, ein Gutmensch? Haben die ein (Hof)Gut, schmecken die gegrillt lecker, können die alles gut, machen die alles gut, oder versuchen die einfach nur, ein bisschen gut zu sein? Ich kann mit der Zuschreibung wenig anfangen, obwohl ich schon so tituliert wurde.
Nun schwappt die heiße Wut der Diskutanten schon seit einer Weile durch alle Kanäle und scheint nicht an Intensität abnehmen zu wollen. Selbst über den Sommer, da man die Leute leichtfertigerweise hat reisen lassen, auf Teufel komm raus (und er kommt gerade wieder raus!), konnte nichts vor allem die Covid-Wütenden besänftigen. Im Gegenteil fantasierte man von einer neuen Verfassung – geschrieben von Wutbürgern. Noch so ein Terminus, der im Unklaren existiert. Kommt die Wut vom Bürger-Sein oder eher davon, dass man sich nicht als Bürger fühlt? Ist man dauernd wütend, oder hat man auch mal gute Laune? Oder hat sich jemand am Ende beim Anfangsbuchstaben vertan: Wut – Tut – Gut…?
Ich glaube ja, dass das was mit dem Unterschied zwischen schnellem und langsamem Denken zu tun hat (Danke noch mal an Daniel Kahneman). Die Weise, in der wir heute die Welt wahrnehmen, unterscheidet sich doch deutlich von der, welche die Generationen vor uns zur Verfügung hatten. Quasi ungefiltert (und unkuratiert) knallen 24/7 Informationen auf unsere Augen und Ohren. Eine unvorstellbare Überforderung, selbst für jemanden, der sich bewusst mit dem Bewerten und Kuratieren von Informationen befasst. Dieses mediale Dauerfeuer aktiviert zwangsläufig unser schnelles Denken – und damit das analytische Verkürzen, das Stereotypisieren, die emotionale Beurteilung von Sachverhalten. Denn eine rationale, reflektierte Beurteilung ist erst mit dem langsamen Denken möglich. Weil wir aber die digital fear of missing out haben, können wir uns diese Zeit jetzt nicht nehmen; wir könnten ja den nächsten heißen Scheiß verpassen…
Dieser Umstand lässt sich natürlich herrlich für die Manipulation von Menschen nutzen. Ein bisschen Re-Framing hier und etwas Propaganda dort und schon kommen Menschen wie du und ich zu solchen Aussagen: “Da sind keine Nazis da bei den Covid-Demonstranten, keine Reichsbürger, Esoteriker und Verschwörungs-Wahnhaften – das sind einfach nur besorgte Bürger, so wie ich…! SO WIE ICH! Wie könnt ihr Systemlügner es wagen, uns mit Nazis in einen Topf zu werfen…?” Nun ja, vielleicht, weil ihr euch mit Ihnen gemein gemacht und euch somit selbst in diesen Topf geworfen habt…? Das ist ein Beispiel für ein gesellschaftliches Feld, auf dem diese Mechanismen gegenwärtig wirksam sind. Zugegeben das größte und gefährlichste, aber bei genauer Betrachtung finden wir ähnliche Verhaltensweisen überall.
Um den Mechanismus zu wissen, macht es kein Jota leichter, diese Menschen zu ertragen, die sich in irgendwelche Konstrukte verrennen, um all dem einen Sinn zu geben – denn da ist kein Sinn. Covid19 ist weder Gottes Strafe für unseren Hedonismus, noch ein Stein, den das Schicksal aus Boshaftigkeit in MEINEN Weg gelegt hat. Es passiert einfach, weil Natur passiert. Und wir Menschen – Karma sei Dank – noch sehr weit davon entfernt sind, uns die Erde wahrhaft untertan zu machen. Da gab’s mal diesen Witz: Treffen sich zwei Planeten. Sagt der Eine: “Du, ich hab Homo Sapiens!”. Darauf der Andere: “Mach dir nix draus. Das geht vorbei…” Vielleicht wäre es ein Ansatz für etwas mehr Frieden auf unserer Welt, allen Menschen klar zu machen zu versuchen, dass das Leben einfach passiert und manche Dinge keinen Sinn ergeben, auch wenn wir partout danach suchen wollen. Denn Ungewissheit ist natürlich schmerzhaft für ein Wesen, das glaubt, Kontrolle über sich und sein Umfeld zu haben…
Ehrlich, ich habe schon eine Ahnung was ich eigentlich will – kurzfristig ist das auch einfach. Gesundheit für meine Lieben und mich. Ein Projekt zu einem guten Abschluss bringen. Ein schönes Wochenende mit Freunden, wenn es denn möglich ist. Weniger unüberlegtes, verbal-aggressives Zuspammen von Kommentarspalten So Sachen. Langfristig muss ich darüber allerdings noch mal nachdenken. Und dafür sollte ich mir Zeit nehmen. Denn sonst will ich vielleicht doch wieder nur, was Andere wollen, das ich wollen soll…