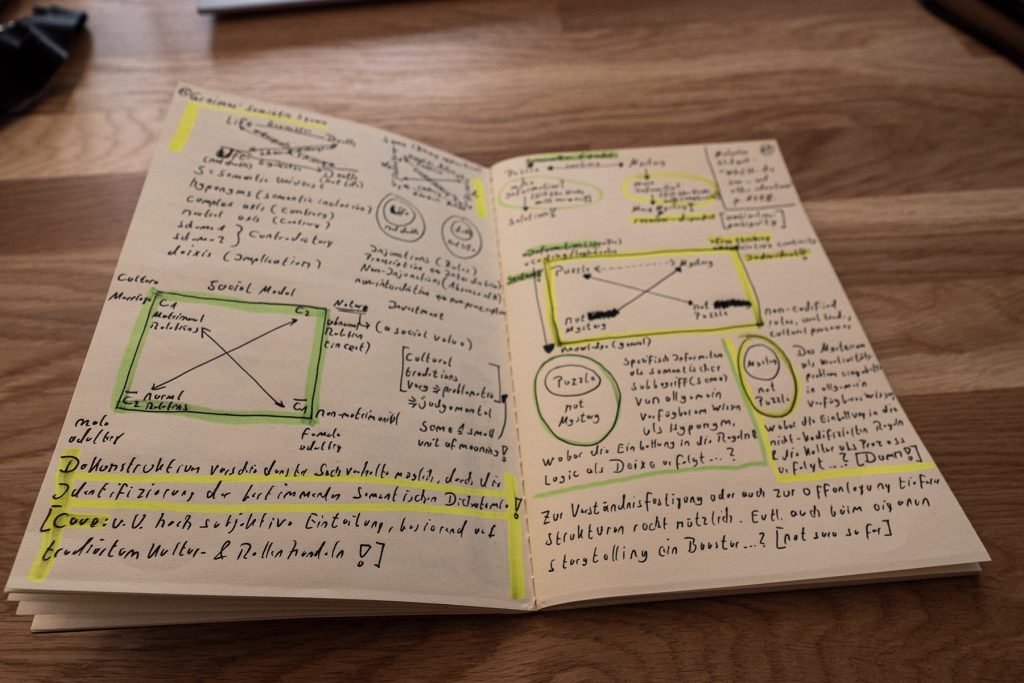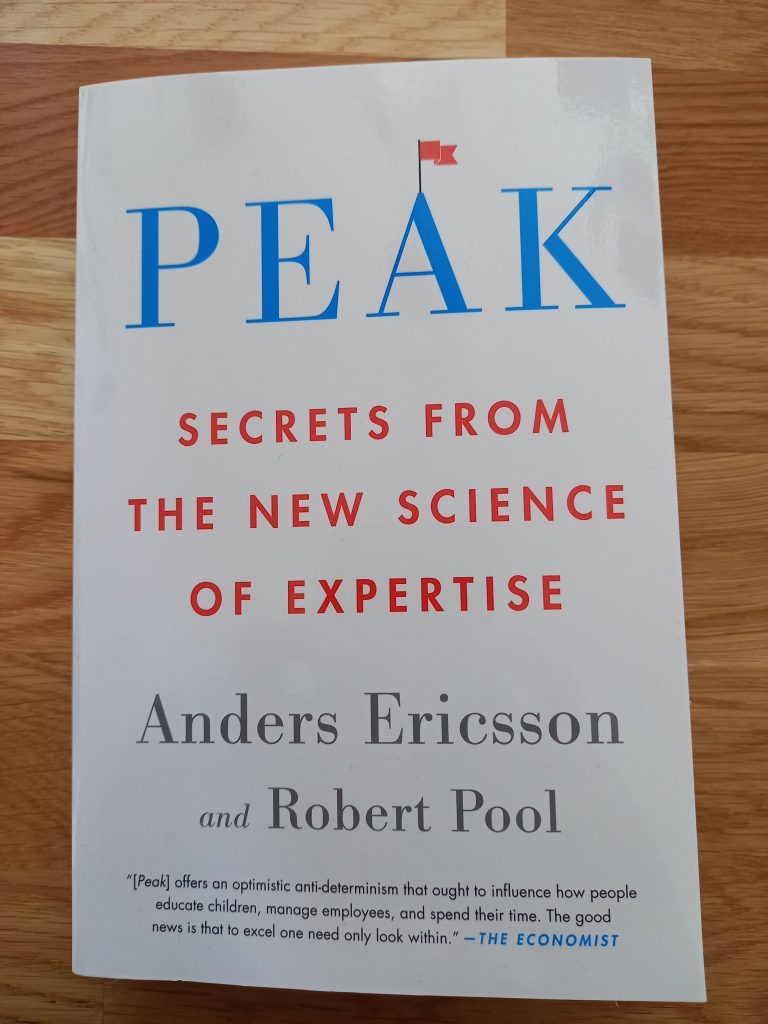Immer mal wieder, wenn ich mit einer neuen Teilnehmergruppe, einer neuen Klasse, neuen Menschen, die frisch in mein angestammtes Gewerk kommen konfrontiert werde – was durch meine Tätigkeit als Ausbilder einigermaßen regelmäßig passiert – geschieht etwas Seltsames. Einerseits freue ich mich stets auf diese Aufgabe, junge Menschen auf ihren ersten, eventuell prägenden Schritten durch das Labyrinth der Notfallsanitäter-Werdung zu begleiten. Andererseits verspüre ich einen gewissen Widerwillen, weil ich in denen, die da, hoffentlich erwartungsvoll, vor mir sitzen etwas sehe, dass ich auch heute noch an mir selbst hasse – Profilneurosen. Und die sind mächtig. Denn ein nicht unerheblicher Teil der “Neulinge” kommt heutzutage mit Vorerfahrung auf die Berufsfachschule. Was bedeutet, dass wir ihnen erst mühsam die ganzen Bad Habits aberziehen müssen, die sie sich auf ihren bisherigen Wachenstandorten “erarbeitet” haben…
Und ich sehe mich dabei selbst; oder besser gesagt, eine deutlich jüngere, arrogantere, unerfahrenere, nervtötendere Version von mir, über die hinauszuwachsen mich Jahrzehnte meines Lebens und die eine oder andere traumatisierene Erfahrung gekostet hat. Ich frage mich dann, ob es wohl eine Abkürzung dahin geben könnte, und muss mir doch jedesmal eingestehen, dass sie wohl allesamt ihre eigenen Erfahrungen machen, in ihre eigenen Untiefen stürzen, ihr eigenes Selbst finden müssen – und dafür das eine oder andere Jahr und den einen oder anderen Rückschlag werden hinnehmen müssen. Das ist der Teil an meiner Arbeit, der mich stets mit Bittersüße, mit entnervender Ambivalenz, aber auch mit einer gewissen Demut erfüllt. Weil ich in diesem Spiegel die Fallen UND die Chancen sehe. Es ist quasi ein Bundle. Du kriegst das eine nicht ohne das andere. Das ist pralles Leben. Was mir immer wieder vor Augen führt, dass dieser Job, bei allen anderen Erfahrungen, die ich gemacht habe, immer noch der Job ist, der mich in mehr als einer Hinsicht erfüllt.

Es gemahnt mich aber auch stest daran, wie wichtig es ist, sich NICHT über diesen Beruf zu definieren. Schlosser, Kaufleute, Informatiker, Forstwirte und Floristen tun das ja auch nicht. Zumindest nicht so sehr, wie es bei den Menschen im Gesundheits- und Sozialwesen ganz offensichtlich häufig der Fall ist. Wir waren schon immer anders, heißt es dann – und viele betonen das offenkundig gerne öffentlich. Ganz so, als wenn es eine Auszeichnung wäre. Ich sehe es heutzutage eher als notwendiges Übel an, und würde mir wünschen, etwas weniger von diesem süßen Gift der Profilneurose genossen zu haben, dass dir die Idee gibt, etwas Besonderes zu sein. Primus inter Pares. Erster unter Gleichen. Denn das sind wir nicht! Ich spreche jetzt mal nur für mich: ich bin nämlich einfach nur ein Typ, der versucht im Rahmen seiner (oft genug begrenzten) Möglichkeiten ein gutes Ergebnis für jene zu erzielen, die ihm anvertraut wurden – egal ob als Patienten oder als Auszubildende. Wobei ich ja seit geraumer Zeit keine Patienten mehr zu sehen bekam. Nichtsdestotrotz gilt mir die Feststellung, einfach nur Mensch zu sein, sehr viel!
Ich war mal wieder in dieser speziellen Situation. Noch dazu in der Abgeschiedenheit eines Teambuilding-Events. Und stehe – wie stets – vor den gleichen komplexen Fragen: wie sehr ich sie an mich ranlassen möchte? Wie sehr ich manche von ihnen jetzt schon schütteln möchte? Wie ich ihre Chancen einschätze, sich NICHT von der Profilneurose bestimmen zu lassen? Wie sympathisch sie mir sind? Was es wohl kosten wird, sie auf den “rechten Weg” zu bringen? Antworten sind Mangelware, aber meine Motivation ist groß. WIr werden sehen. Ich wünsche euch eine gute Woche; und hoffe, dass ihr auch mal in diesen verfluchten Spiegel schaut. Bis die Tage…