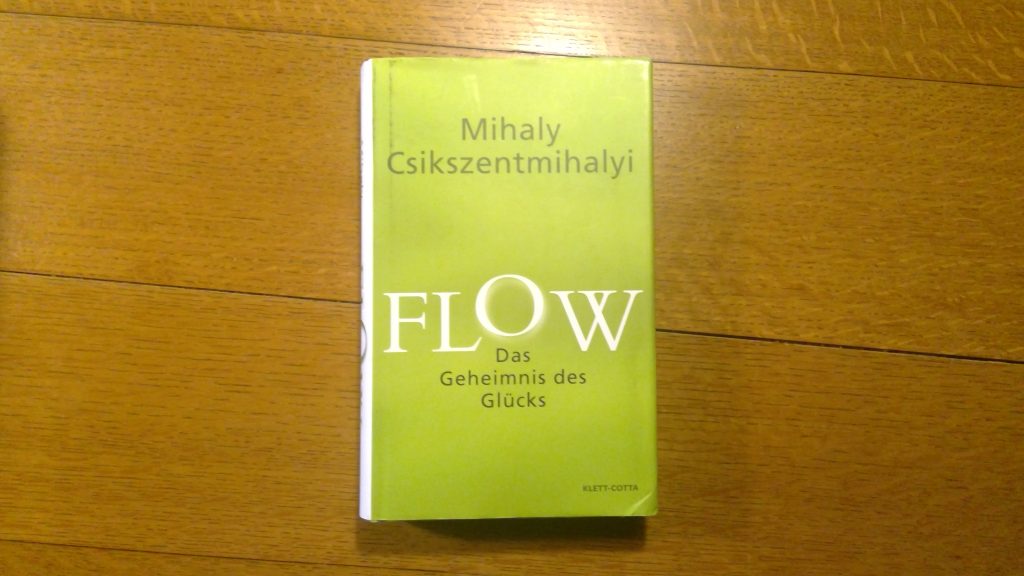“EoSB könnte das neue Problem des Jahres werden, wenn wir bald – nämlich ab Herbst – alle wieder in unsere Hütten gepfercht darauf warten müssen, dass Corona uns auch krank macht!” So, oder ähnlich könnte man jetzt in irgendwelchen mehr oder weniger wichtigen Postillen titeln, die von den Wahlberliner Covidioten natürlich NICHT gelesen werden. Oder man nimmt es einfach zur Kenntnis, dass alles ein Ende hat, nur die… ach ihr wisst schon.
Jetzt mal ehrlich: zweite Welle hin oder her: Don Henleys “The boys of summer” klingt jedes Mal in meinem Hinterkopf, wenn die Tage immer schneller immer kürzer werden, es kaum noch Spaß macht, Abends mit dem Drink auf dem Balkon zu sitzen und man sich, ganz von allein wieder viel lieber drinnen aufhält. Ich gebe es offen zu: auch wenn ich mehr schwitze, als manch anderer, liebe ich den Sommer und könnte noch mehr davon gebrauchen. Nicht wegen Corona, sondern weil der Sommer mir meistens das Leben um einiges leichter macht. Ich lebe dann auf, denn ich bin im Herzen eben eher der mediterrane Typ, der mal Fünfe gerade sein lassen und gediegen in den Tag mäandern möchte. Nicht, dass ich in der Realität allzu oft die Chance dazu hätte. Aber das ist eine andere Baustelle…
Ich will nicht behaupten, dass der Ausweichurlaub in der Lüneburger Heide bisher nicht auch toll gewesen wäre. Schöne alte Städte und andere Ausflugsziele, tolle Landschaft, einen Grill und eine wirklich angenehme Unterkunft haben wir auch hier. Aber, ich will ehrlich sein: mir fehlt der Pool, der mich zu mehr Bewegung einlädt, der warme Geruch der Macchia, der endlos blaue Himmel, die ewigen Abende, die Leichtigkeit, die das alles für mich bedeutet. Das die “Leichtigkeit des Seins” dieses Jahr aus guten Gründen schon seit März ausverkauft ist, tröstet zwar etwas über den rein subjektiven Mangel an Ars Vivendi hinweg – gleichwohl fremdele ich mit all dem Guten, das ich hier habe.
Ich denke, dass dies daran liegt, dass wir modernen Menschen aus den entwickelten Industrienationen den Urlaub auf individuell spezifische Weise ritualisieren. Ich hatte die Tage über die sorglos-schmerzfreie Entgrenzung von Frei- und Arbeitszeit im Rahmen des Lesens und Studierens geschrieben und dabei sinngemäß gesagt, dass zumindest ich als Wissens-Arbeiter den Lebens- und den Arbeitsraum dabei nicht mehr so einfach trennen könnte. Das stimmt wohl. Dennoch führt mich eine weitergehende Selbstanalyse an den Punkt, dass nur das Bewusstsein dieser Freiheit, es nicht tun zu müssen, weil meine freie Zeit zu meiner persönlichen Disposition steht mich zu diesem Schluss kommen lies. Ich denke nach wie vor so, allerdings muss ich nun ergänzen, dass das beschriebene Mindset auch beinhalten muss, seine Freiräume selbst definieren zu dürfen/können.
Womit wir beim Mindset “Urlaub” und dessen individueller Ritualisierung angelangt wären. Denn um sich auf die besonderen freien Zeiten des Jahres einzugrooven, hat ja jeder Mensch so seine speziellen Traditionen. Das beginnt mit dem Packen der Reisetaschen aller Mitreisenden und dem Einräumen Fahrzeuges (sofern man, wie wir, eigentlich immer mit dem PKW verreist), der Struktur der Anreise, den Erwartungen an das Ferien-Domizil, den Plänen für Aktivitäten während des Aufenthaltes und noch tausend anderen kleinen Dingen. Aus all diesen Dingen entsteht bei nicht wenige Menschen – und ich muss mich selbst wohl auch dazu rechnen – ein Urlaubs-Ritual, dass, wenn es gestört wird, ganz erheblich zu Unbehagen führen kann.
Ich hatte mich nie als in so furchtbares Gewohnheitstier gesehen. Aber Unterhaltungen mit der besten Ehefrau von allen, die darauf besteht, wieder mehr Variationen hinsichtlich der Reiseziele erleben zu dürfen, führen mich zu der Erkenntnis, dass ich – verdammtnocheins – langsam zum Urlaubsspießer mutiere. Nicht auf diese uncharmante “Mein-Badetuch-mein-Liegestuhl”-Art, sondern eher bezüglich einer gewissen Erwartbarkeits-Erwartung; ich brauche wohl heutzutage eher das Bekannte, weil es meinen unruhigen, stressgeplagten Geist sicher und schnell erdet, beruhigt, entspannt; also ganz sicher und schnell auf Ruhe-Niveau runter fährt. Und ich bin mir einfach noch nicht sicher, ob die Lüneburger Heide das annähernd so gut kann, wie die Toskana (wir werden sehen).
Subsumierend lässt sich sagen, dass mein Sommer subjektiv bislang einfach Scheiße war und ich deshalb ein bisschen rum heulen muss, weil mir der Süden so sehr fehlt und die Chance auf richtigen Sommer nun mal sehr bald dahin ist. Ich werde darüber hinweg kommen, aber es macht mich einfach nicht glücklich. Ich wünsche euch dennoch schon mal einen verdammt schönen Herbst und uns allen einen goldenen September. Vielleicht tröstet mich ja bald der Ferderweiße ein wenig. Schöne Woche.