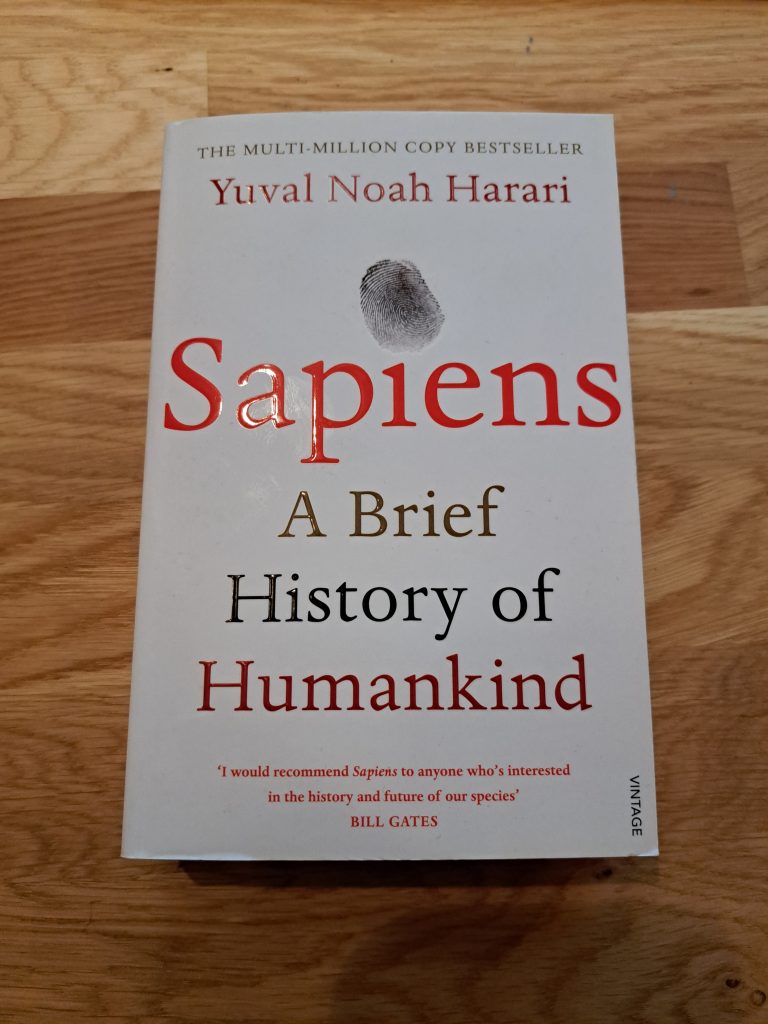Um die Essentials auf den Punkt zu bringen: auch Berufsfachschulen haben einen Erziehungsauftrag! In einer Zeit, in der nicht wenige (vor allem junge) Menschen so ihre Probleme damit haben, in der dynamischen Realität einer sich – subjektiv dauernd – weiter partikularisierenden Welt anzukommen, ist es verdammt schwierig, Vorbild zu sein; weil man ja gar nicht weiß, A) welche Qualitäten das jüngere Gegenüber nun wirklich in einem Vorbild sucht, B) Menschen meines Alters per definitionem “cringe white middle-aged cis-gender males” sind und C) ja eh keine Ahnung haben, wie das alles funktioniert, weil wir halt einfach Schuld sind. Woran, ist oft genug egal. An dieser Stelle wichtig: no insults taken, no fucks given. Ich jammere nicht drüber, sondern nehme das einfach hin, und bleibe, der ich war und bin. Wir sind also auf dem unebenen Terrain der Persönlichkeitsbildung angekommen, die auch ohne den ganzen Internet-Quatsch, die ganzen Unsicherheiten und verschiedene gesellschaftliche Großtrends (weniger Solidarität, mehr Egoismus, häufig Style over Substance, etc. – ich habe doch schon mehr als genug drüber gelabert…) schon immer schwierig genug gewesen ist. Ich war auch mal dort, wisst ihr.
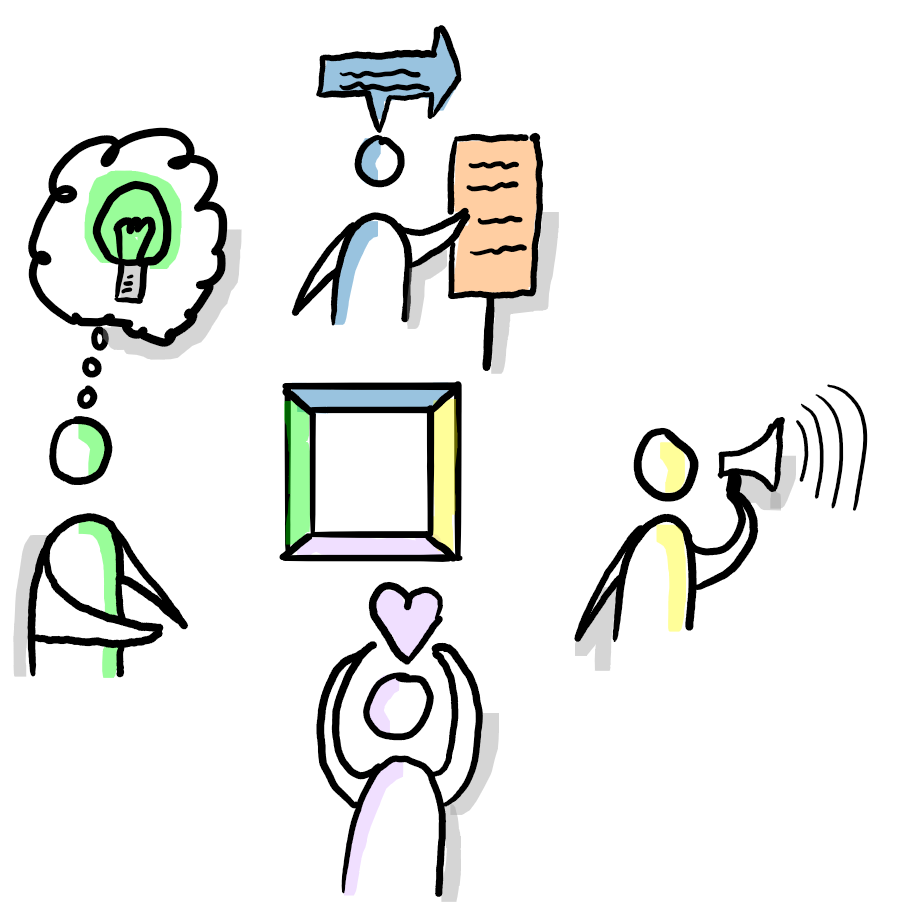
Ich könnte mich jetzt darauf zurückziehen, es halt nur bei meinen Kindern zu versuchen; also das Erziehen meine ich. Und ich sage bewusst versuchen, denn in der Erziehung ist es wie im Krieg – noch kein Schlachtplan hat die erste Berührung mit dem Feind unverändert überstanden. ABER, ich bin eben auch Leiter einer Berufsfachschule. Und entgegen dem, was ich oft sehe – nämlich das die jungen Leute schlicht normiert und zu funktionierenden Vitalparameter-Mechanikern*innen gedrillt werden – habe ich einen eher Persönlichkeits-orientierten Ansatz. Ohne das richtige Bewusstsein für die eigene (Berufs-)Rolle, und vor allem auch das Werkzeug, diese bedarfsflexibel anpassen zu können, passieren mit den jungen Leuten nämlich zwei Dinge: Erstens werden sie verdammt schnell von der Alltagsrealität eingeholt, dass die weitaus meisten Patienten keinen lebensbedrohlichen Notfall nach Definition IHRES Handbuches haben, sondern irgendwelche sozialen, psychologischen, wirtschaftlichen Probleme, die Mangels Verfügbarkeit besser geeigneter Instanzen aus Sicht der Hilfesuchenden im Ruf eines RTWs münden. (der verlinkte Artikel ist auf Zeit Online hinter der Paywall, allerdings bisher eine der besten Reportagen, die ich je dazu gelesen habe). Das führt zweitens in der Folge zu Desillusionierung und nicht selten zu einem zügigen Berufsfwechsel (=> Fachkräftemangel anybody…?).
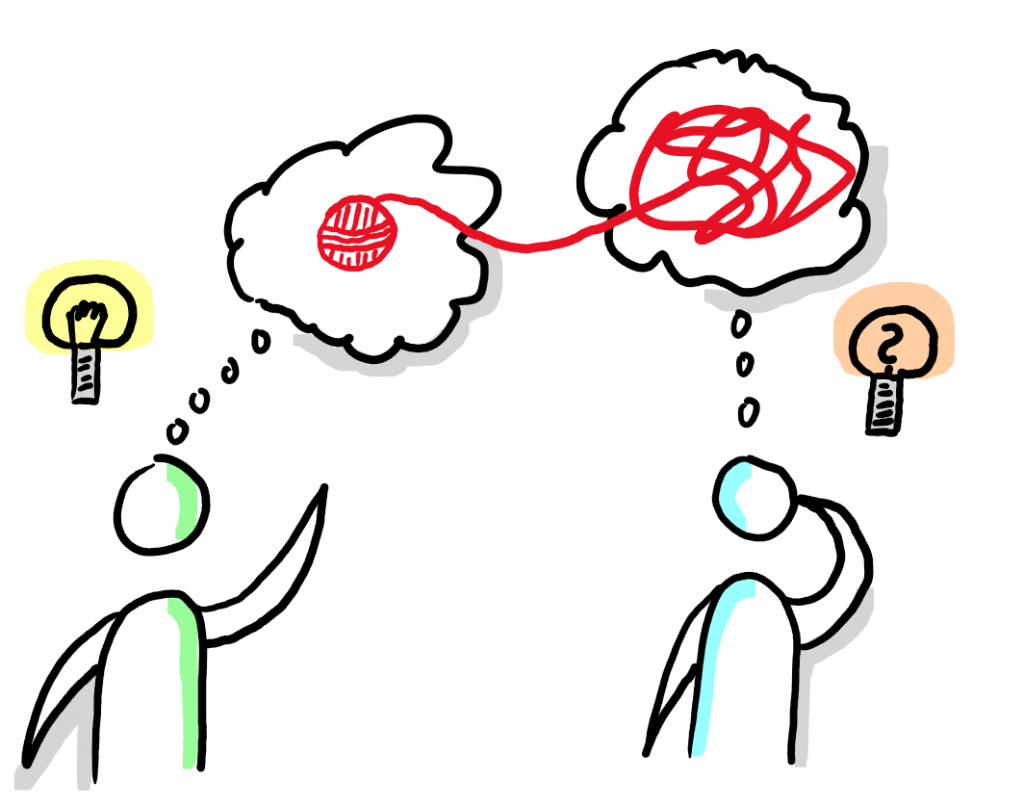
Okay, ich habe erklärt, WARUM ich einen Erziehungsauftrag in der Berufsfachschule sehe. Das erklärt aber natürlich noch keinen Meter, WIE man das dann anstellt, wenn es doch oft genug einen gewissen Graben zwischen Fachlehrer*in und Schüler*innen gibt? Und der resultiert nicht immer aus dem Alter der Fachlehrer*innen. Häufig genug werden heute sehr junge Kollegen*innen in den “Schuldienst” rekrutiert, wenn sie schon früh ein gewisses Talent für die Betreuung von Auszubildenden zeigen. Es ist aber ein himmelweiter Unterschied, auf seinem Rettungswagen, oder bei Praxisanleitungen auf der Wache ein paar wenige Individuen an die Hand zu nehmen, oder vor einer vollen Klasse zu stehen, in der naturgemäß kein dauerndes Eingehen auf Partikularbedürfnisse möglich ist. Es kommt in der Folge immer wieder zu folgenden Prozessen:
- Mangelnde analytische Distanz: Da man der im Lehrsaal vertretenen Peergroup subjektiv näher ist, verwechselt man Schüler*innen mit Freunden oder Kollegen. So funktioniert Lehren aber nicht! Denn am Ende muss ICH unzweifelhaft objektiv bewerten können, ob die Person vor mir für diesen Job geeignet ist, oder nicht. Und “Oder nicht” ist niemals eine populäre Ansage!
- Doppelbelastung Studium – Lehre: Das muss man wollen. Und es wird von so manchem Schulleiter auf Lehrerfang gerne freundlich kleingeredet, dass man bis zum Abschluss oft genug auf dem Zahnfleisch gehen wird… Folglich schmeißen nicht Wenige alsbald das Handtuch und suchen sich was anderes.
- Unsicherheiten im Umgang mit dem Curriculum: Da steht eine Menge Zeug drin, das nicht auf den ersten Blick intuitiv zugänglich ist. Warum man manchmal Umwege gehen muss, um ans Ziel kommen zu können, erschließt sich einem oft erst mit wachsendem Alter und zunehmender Erfahrung.
Zusammengefasst braucht es eine gewisse charakterliche und fachliche Reife, um junge Erwachsene für das Berufsleben fit machen zu können. Kommen wir direkt zum WIE zurück: Fachlehrer*innen sind Role-Models! Vorbilder! Um dies sein zu können, müssen Sie aber über ein paar Eigenschaften verfügen, die aus meiner Erfahrung heraus unabdingbar sind, um Persönlichkeitsbildung im Gegenüber ermöglichen zu können: Situationsadäquate Kommunikation. Zuverlässigkeit. Integrität. Führungsstärke. Fachwissen und Fertigkeiten. Diese Dinge wachsen jedoch nicht auf Bäumen, sondern nur durch angeleitete Erfahrung in den Fachlehrer*innen selbst. Das bedeutet, bevor das Lehrpersonal erzieherisch tätig werden kann, muss es erst mal selbst erzogen werden! Menschen lernen relativ viel am Modell und durch Imitation, was schließlich durch Reflexion des Erlebten und Gefühlten zur Integration in das eigene Handlungsrepertoire führt / führen kann. Abkürzungen funktionieren hier NICHT! Und das ist bei sozialen Skills leider nicht anders. Was bedeutet, dass sowohl unser Unterricht, als auch unser kollegialer Umgang miteinander nicht nur fachlich, sondern auch sozial fordernd sein muss. Lernen ist eine Zumutung, die nur außerhalb der Komfortzone wirklich zum Erfolg führen kann. 24 Folien Powerpoint pro Sekunde mögen einen Film ergeben – Notfallsanitäter*innen, welche diese Bezeichnung auch wirklich verdienen, ergibt das aber nicht! Wie man die Schüler*innen tatsächlich aus ihrer Komfortzone und hinein in echtes Lernen holt, dafür gibt es übrigens genausowenig eine Musterlösung, wie für die Notfallbilder, welche erlernt werden müssen – auch wenn Schüler*innen niemals müde werden, danach zu fragen.
GOTT WÜRDE ICH MICH FREUEN, WENN JEMAND MIT MIR ZU DISKUTIEREN ANFINGE! Schönen Tag noch.